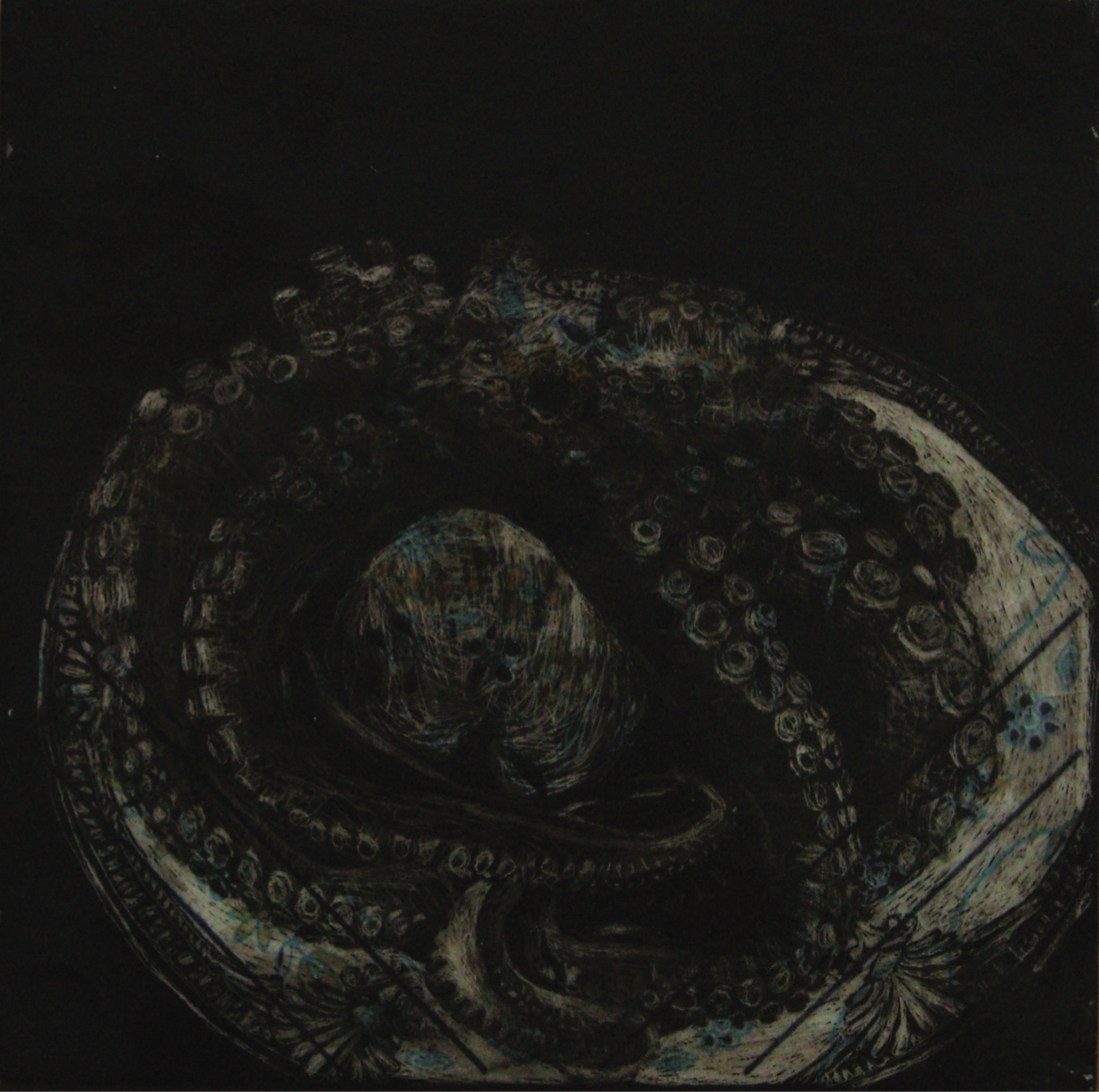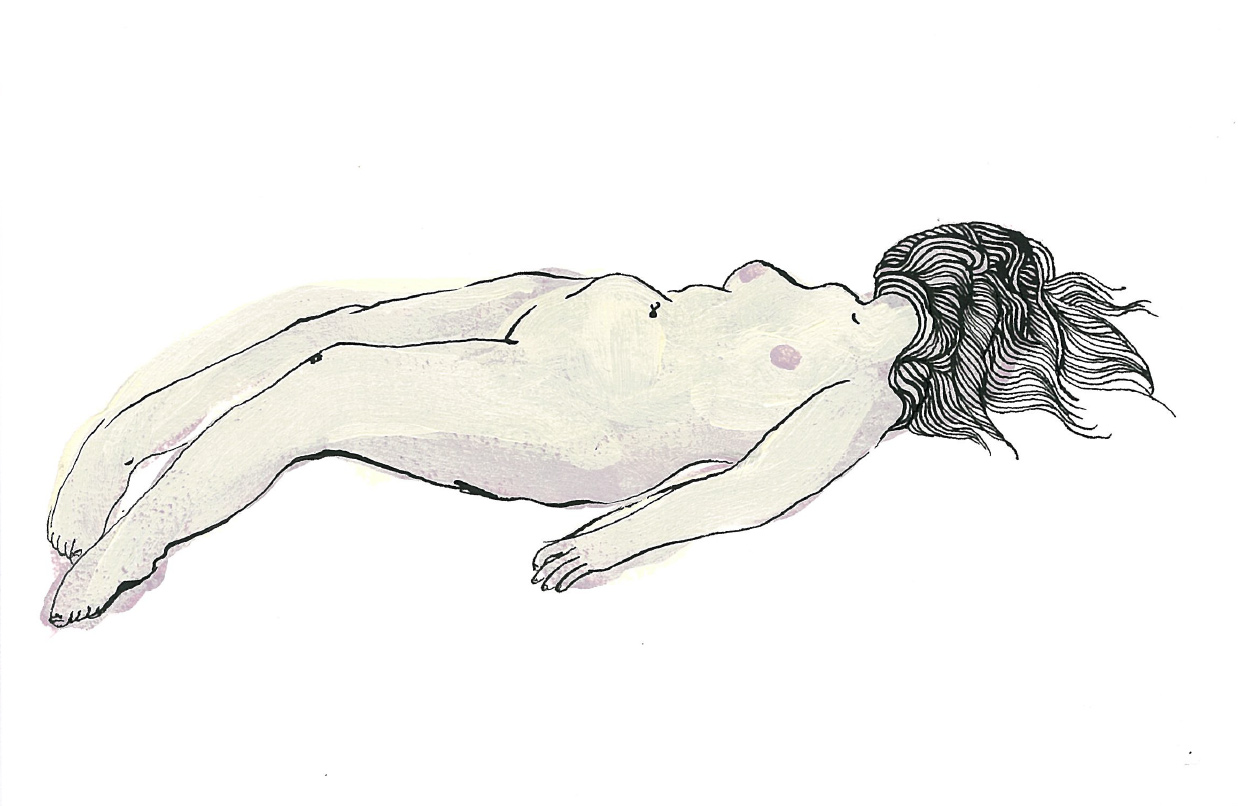RENE BURRI
TWO WORLDS
Zwei Ausstellungen mit René Burri.
Kuratiert von Guido Magnaguagno und Brigitte Ulmer
René Burri, geboren 1933 in Zürich, gehört zu den international bedeutendsten Fotografen unserer Zeit. Er schuf Ikonen der schwarz/weiss-Fotografie, die in unser Gedächtnis eingesickert sind: das Bild von Che Guevara mit Zigarre oder das dramatische Männer-Ensemble auf dem Dach eines Hochhauses von São Paolo, Picasso auf dem Hotel-Bett, Bildserien von Le Corbusier sowie Reportagen aus der Retortenstadt Brasilia. Burri fotografierte weltbewegende Ereignisse und destillierte daraus symbolhafte Zeitbilder. Für sein Lebenswerk wird er am 8. April mit dem Swiss Press Photo Life Time Achievement Award ausgezeichnet. Das Kulturmagazin «Du» widmet dem Fotografen seine aktuelle Jubiläumsnummer.
Der Titel der Doppelausstellung «TWO WORLDS» — eine Reminiszenz an die erste Retrospektive «One world», die das Kunsthaus Zürich 1984 dem Fotografen widmete — spielt auf das fotografische Doppelleben von René Burri an. Obwohl als Mitglied des legendären Fotografen-Kollektivs Magnum der humanistisch engagierten Fotografie in schwarz/weiss verpflichtet, fotografierte er stets auch in Farbe. In den letzten Jahren sichtete Burri sein umfangreiches Archiv, das Tausende von Farbdiachromes aus sechs Jahrzehnten beinhaltet. Die zweiteilige Ausstellung stellt nun das schwarz-weiss Oeuvre dem Farbwerk gegenüber.
René Burri ist nicht nur der rastlose Fotojournalist, sondern mit sicherem Instinkt fürs historische Weltgeschehen leuchtete er immer auch hinter und neben die Ereignisse. Er hat seine Fotografie stets als Medium verstanden, um Utopien und Hoffnungen der Gesellschaft zu reflektieren. Mit einem Blick, der in der Fotoklasse von Hans Finsler geschult wurde, suchte er aber auch nach seinem persönlichen Ausdruck, ohne Stildogmen zu verfallen.
«Ich habe meine Leica dabei, wie ich sie immer dabei hatte. Ich beobachte, notiere mit ihr. Ich möchte mit Auge, Herz und Hirn an der Welt teilnehmen, dabei sein und festhalten, was um mich herum passiert.»
Rene Burri im Du-Interview der März-Nummer. «70 Jahre Du. Eine Begegnung mit René Burri».
René Burri wird an beiden Vernissagen anwesend sein.
PART II – BLACK & WHITE. 5. bis 19. März
Galerie BurgerStocker, Mühlebachstr. 2, 8008 Zürich
Vernissage: 4. März 2011, 18 Uhr.
Opening talk 19 Uhr: «Die Lust des Chronisten», Marco Meier, Publizist.
Die Ausstellung mit dem Schwarz-weiss-Werk spannt einen Bogen über sein vielfältiges Schaffen, in dem sie sich auf Schwerpunkte konzentriert: Sein Frühwerk in der Schweiz, Kuba, ebenso wie China, Südkorea, Japan und Brasilien — Ländern, in denen Burri am intensivsten gearbeitet hat. Darunter finden sich auch zahlreiche Fotografien von Brasilia, der von Oscar Niemeyer erbauten Retorten-Stadt, die Burri zwischen 1960 und 1993 dokumentierte.
Bild-Ikonen werden gezeigt wie «Gesundheitsministerium, Rio» (1960) und «São Paolo» (1960), in denen Burri spannungsvolle Bildarchitekturen schuf, ebenso wie lyrische Bilder, in denen er mit dem Augenblick flirtete, Bilder von mythischen Figuren wie Picasso und Che Guevara, und immer wieder auch tänzerisch-leichte, sinnliche Bilder von Frauen und Liebenspaaren.
Ausserdem werden alte Nummern von «Du» präsentiert, die René Burris Fotografien in ihrer Wirkungskraft im Rahmen des Magazin-Journalismus zeigen.
Brigitte Ulmer
«…anders als andere Grosse ist es ihm gelungen, sich jeder Einordnung in einen Stil oder eine Schule zu entziehen und zugleich seine eigene, unverwechselbare fotografische Handschrift zu entwickeln. Die Intensität seiner Bilder speist sich aus einer Neugierde, die Fotografie mitten aus dem Leben heraus entstehen lässt, und dem Leben verpflichtet ist, dem Dienst an der Humanität. Dass er seine Bilder in die Tiefe hinein komponiert, wurde mit Blick auf seine Ästhetik immer wieder konstatiert. Zudem lässt sich von einer historischen Tiefe in seinem Werk sprechen: Burri interessieren insbesondere Gegenden, in denen sich vor dem Hintergrund einer reichen Geschichte und Kultur Alltag zuträgt; Europa, der Nahe Osten, China. Er bleibt in gewisser Weise Journalist und zugleich ein Schüler Hans Finslers – überlegt in der Bildgestaltung, ein Meister der Komposition.»
Daniele Muscionico in «Du», März 2011
«Burri dringt ein, will Nähe, Unmittelbarkeit, Nerv.»
Dieter Bachmann in «Du», März 2011.
Ein Preis und zwei Neuerscheinungen / Biografie
René Burri wird am 8. April mit dem Swiss Press Photo Life Time Achievement Award ausgezeichnet.
70 Jahre Du. Eine Begegnung mit René Burri – Soeben erschienen.
Seit über 50 Jahren ist René Burri mit dem Kulturmagazin Du verbunden. Die Jubiläumsausgabe ist dem Fotografen und Weltensammler gewidmet und wurde in enger Kooperation mit ihm gestaltet. Das Magazin erscheint mit einem Schwarz/Weiss- und einem Farb-Cover – ein augenzwinkernder Verweis auf Burris fotografisches Doppelleben.
Erhältlich am Kiosk, im Buchhandel und während der Ausstellungen in den Galerien.
René Burri. Brasilia. Fotografien 1960-1993. Hrsg. Arthur Rüegg. Verlag Scheidegger & Spiess. Neuerscheinung. René Burri dokumentierte den Bau und den Alltag von Brasilia, einer Ikone der Architektur und Städteplanung, die buchstäblich ins grüne Feld gepflanzt wurde. Der Bild- und Textband handelt von einer gebauten Utopie, von Anstrengung und Aufbruchstimmung.
Biografie
René Burri wurde am 9. April in Zürich als Sohn eines Kochs geboren.
1949-1953 Studium an der Kunstgewerbeschule Zürich. Vorkurs bei Johannes Itten. Fotoklasse von Hans Finsler und Alfred Willimann.
Ab 1953 Arbeit als Kameramann für Walt Disney Filmproduction und Reporter.
1955 Erste Fotoreportage in «Life»
1956 Korrespondierendes Mitglied der Agentur Magnum.
1956-1958 Reisen nach Deutschland, Sizilien, Ägypten, Tschechoslowakei, Irak, Jordanien, Libanon, Syrien.
1959 Vollmitglied bei Magnum. Porträtiert Picasso in Südfrankreich.
1961-1964 Reisen nach Brasilien, Iran, Japan, Südkorea, Thailand, Kuba, wo er erstmals Fidel Castro trifft.
1967 Erste Einzelausstellung im Chicago Art Institute Museum in Chicago.
1968-1970 Reisen nach Südafrika, Mexiko, in die USA.
1972 Beteiligung an der Ausstellung «Behind the Great Wall» im Metropolitan Museum of Art, New York.
1973-1980 Reisen nach Vietnam, Kuba, Kuwait, Saudi-Arabien, Oman, Brasilien, England, Argentinien, Libanon, Deutschland.
1984 Retrospektive «One World – Thirty Years of Photographs» im Kunsthaus Zürich, in Paris und Lausanne.
1987-1993 Reisen nach Südkorea, Moskau, Kairo, Berlin (Mauerfall), Tokio, Beirut, Kuba.
2004 «René Burri – Retrospective 1950-2000» im Maison Européenne de la Photographie Paris, Berlin, Lausanne, Mailand, Zürich, Manchester, Rotterdam, Wien, Kuba, Mittel- und Südamerika.
2007 «René Burri – Un mundo», Wanderausstellung u.a. in Mexico City und Bogota.
2010 «René Burri. Das Werk», Museum für angewandte Kunst in Köln.
«René Burri – Le Corbusier», Museum Bellerive, Zürich.
2010-2011 «René Burri. Fotografien», KunstHaus Wien.
PART I – COLOUR. 4. bis 19. März
Barr & Ochsner, Dealers in Fine Art
@ Gallery Neumarkt 17, Predigergasse 14, 8001 Zürich
Vernissage: Donnerstag, 3. März 2011, 19 Uhr
Opening talk 20 Uhr: Eskapaden in Farbe, Guido Magnaguagno, Kurator.